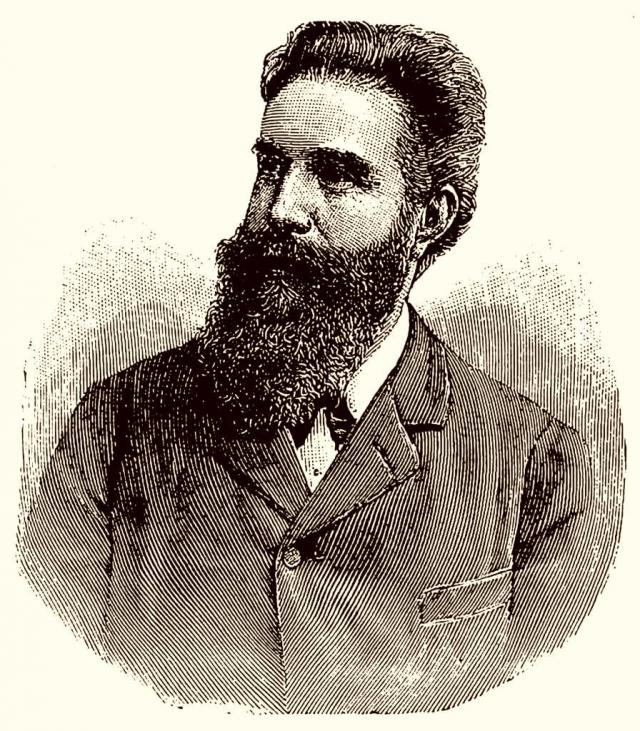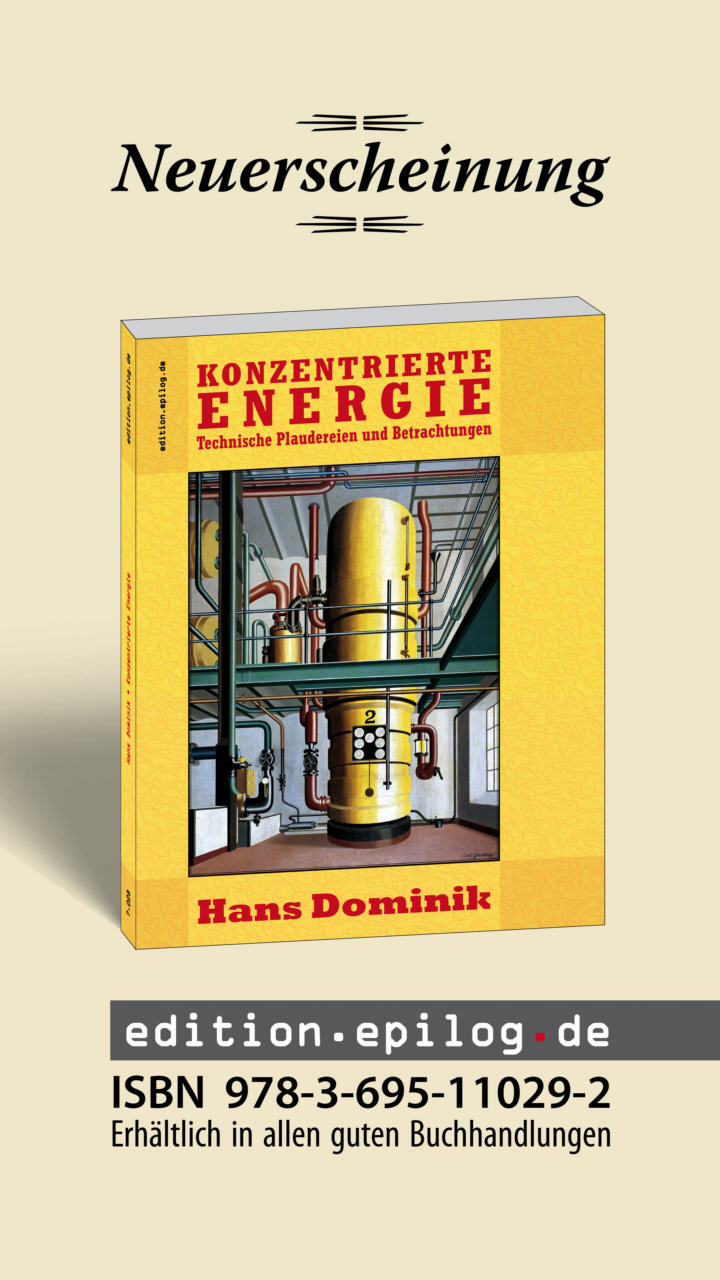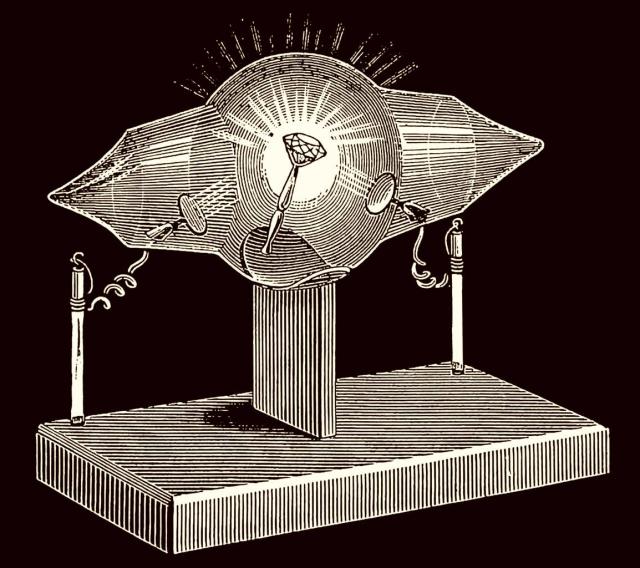Forschung & Technik – Wissenschaft
Siegfried Hartmann
Lebendige Kraft
Naturwissenschaftlich-Technische Plaudereien • 1908
»Entschuldigen Sie!«
»Bitte sehr«, knurrte ich mit sauersüßer Miene. »Sie müssen sich nur festhalten, mein Herr!«
Mein Gegenüber auf der Plattform der Straßenbahn, ein großer, starker Herr, übte sich in der Kunst, frei zu stehen. Jedes Mal, wenn der Führer die Bremse wirken ließ, mühte er sich krampfhaft, das Gleichgewicht zu halten, um entweder liebevoll seine ganze Gestalt an meine Brust zu pressen, oder mir durch einen Tritt auf meine neuen Lackschuhe einen Beweis von der Größe seines Körpergewichts zu liefern.
»Der Führer hält so ungeschickt an.«
»Sehr sanft betätigt er die Bremse nicht«, gab ich zu, »aber gerade deshalb muss man sich festhalten, zumal wenn man über eine ziemlich bedeutende Masse verfügt.« (Die Unhöflichkeit dieser Bemerkung sehe ich ein, aber wenn man bereits vier Tritte auf neue Lackschuhe bekommen hat, ist eine verärgerte Stimmung erklärlich.)
»Masse, wieso?«
»Nun, ich meine, ein starker und gewichtiger Mensch wie Sie verliert das Gleichgewicht eher als ein kleiner, leichter, schmächtiger.«
»Das sehe ich nicht ein!«
»Das ist aber eine alte Erfahrung: m × v² / 2.«
»Wie bitte?«
Der Herr war offenbar kein Lehrer der Physik und Mechanik, sonst hätte er die tiefsinnige und lakonische Kürze meiner Antwort gewürdigt.
»Ich habe Sie nicht verstanden«, wiederholte er, als ich schwieg.
»Es war bloß eine Formel, der mathematische Ausdruck für das Naturgesetz, unter dessen Wirkung Sie das Gleichgewicht verloren.«
»Das interessiert mich, wollen Sie mir das nicht näher erklären?«
Ich hatte zwar wenig Lust, meinem Peiniger auf der Plattform des Straßenbahnwagens naturwissenschaftlichen Unterricht zu erteilen, doch Europas übertünchte Höflichkeit fordert nun einmal auch in solchem Fall, dass man artig antwortet.
»Die Formel drückt aus, dass die Größe der lebendigen Kraft abhängig ist von der Masse und dem Quadrat der Geschwindigkeit.«
Die Augen meines Gegenüber verrieten mir deutlich, dass ein chinesischer Sinnspruch ihm ebenso verständlich gewesen wäre. Mich ergriff ein gewisses Mitleid. Ich musste deutlicher werden.
»Wenn Sie einen Tennisball und eine Billardkugel gegen eine starke Glasscheibe werfen, so ist die Wirkung zweifellos verschieden. Nicht wahr? Die elfenbeinerne Billardkugel ist schwerer, hat eine größere Masse als der leichte, mit Sägespänen oder dergleichen gefüllte Tennisball. Die Billardkugel wird die Scheibe zertrümmern, der Tennisball wird abprallen.«
»Ja, die Billardkugel ist auch härter.«
»Gewiss, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Sie können sich den Tennisball auch durch eine dünnwandige Blechhohlkugel ersetzt denken, die etwa mit Watte vollgestopft ist. Dann ist die Härte der Schale noch größer als die der Elfenbeinkugel, und trotzdem wird die leichte wattegefüllte Blechkugel bei weitem nicht den Schaden anrichten wie der Elfenbeinball. Wesentlich für die zertrümmernde Kraft der Kugel ist ihr Gewicht. Je schwerer die Kugel, desto größer ihre zerstörende Kraft, und zwar steht beides in einem ganz bestimmten einfachen Verhältnis; doppeltes Gewicht, doppelte zerstörende Kraft; dreifaches Gewicht, dreifach zerstörende Kraft usw. Das nennt man dann direkt und einfach proportional.« Bis hierher hatte mir mein freiwilliges Opfer geduldig zugehört. Jetzt unterbrach er mich.
»Aber es kommt doch darauf an, mit welcher Wucht ich die Kugel schleudere.«
»Ganz gewiss. Das heißt, die Wucht, mit der Sie schleudern, hat nur einen mittelbaren Einfluss. Die Geschwindigkeit, die die Kugel im Moment des Auftreffens hat, ist das maßgebliche, und die Geschwindigkeit hängt natürlich von der Größe der Schleuderkraft ab, aber auch von dem entgegentretenden Luftwiderstand. Ja, die Geschwindigkeit hat eigentlich einen noch viel größeren Einfluss auf die zerstörende Kraft des Wurfgeschosses wie das Gewicht. Verdoppele ich nämlich durch kräftigeres Werfen die Geschwindigkeit, so verdoppele ich die zerstörende Kraft nicht bloß, sondern ich vervierfache sie; verdreifache ich die Geschwindigkeit, so verneunfache ich sie; vervierfache ich die Geschwindigkeit, so versechzehnfache ich die zerstörende Kraft usw. Mit den Worten des Fachmannes: Die zerstörende Kraft wächst mit dem Quadrat der Geschwindigkeit. Selbstverständlich trifft der Ausdruck zerstörende Kraft nicht immer zu. Man sagt auch meistens nicht so, sondern ›lebendige Kraft‹. Sie haben mich vorhin durch Ihre wiederholten unfreiwilligen Umarmungen auch nicht zerstört, höchstens den Lack auf meinen Schuhen. Aber oft wird doch im täglichen Leben die lebendige Kraft schließlich zur zerstörenden Kraft.
Man denke nur an die zur Vernichtung von Tier- und Menschenleben bestimmten Geschosse: den Ger der alten Germanen, die Schleudern der alten Römer, die Armbrust des Mittelalters und die modernen von Pulvergasen getriebenen Projektile unserer Gewehre und Geschütze. Früher suchte man die lebendige Kraft durch Vermehrung der Masse zu erhöhen. Die Bezeichnung der Kanonen der alten Linienschiffe nach dem Gewicht der geschleuderten Kugeln als Sechspfünder, Zwölfpfünder, Vierundzwanzigpfünder zeigt das deutlich. In neuerer Zeit sucht man dagegen die Geschwindigkeit zu erhöhen und wird darin unterstützt durch die neuen Hilfsmittel der Sprengstoffchemie, die es erlauben, in einer kleinen, engen Hülle eine ungeheure Kraft aufzuspeichern und plötzlich auszulösen, um mit rasender Eile das Geschoss aus der Mündung zu treiben. Man erreicht auf diese Weise die gleiche zerstörende Wirkung mit einem kleineren, leichteren Geschoss, das in größeren Mengen mitgeführt werden kann, wie früher mit einem bedeutend schwereren, aber mit geringerer Geschwindigkeit geschleuderten.
Hier handelt es sich um gewollte Zerstörung. Aber die lebendige Kraft eines in Bewegung befindlichen Gegenstandes trifft auch oft ungewollt als zerstörende Kraft auf. Die furchtbaren Verheerungen beim Zusammenstoß zweier Züge oder zweier Dampfer auf See finden ihre naturwissenschaftliche Erklärung in der oben genannten Formel. Hier stellt sich die Natur unserem Geschwindigkeitshunger entgegen. Wir wollen so schnell wie möglich fahren, und mit jeder Vermehrung der Geschwindigkeit wächst die ›lebendige Kraft‹ ganz riesenhaft, wie schon gesagt um das Vierfache bei verdoppelter Geschwindigkeit.
Hier das Kabel, das zwischen Anhängewagen und Motorwagen hängt, verdankt sein Dasein auch den unliebsamen Wirkungen der lebendigen Kraft.
Als man zuerst mit elektrischen Motorwagen fuhr und alte Pferdebahnwagen anhängte, machte man die sehr unerwünschte Beobachtung, dass die lebendige Kraft des Anhängers unter Umständen so groß war, dass die Bremse des Motorwagens den Zug nicht zum Halten brachte, dass vielmehr der Anhängewagen den Motorwagen mit festgebremsten Rädern noch vor sich herschob. Da das für die Sicherheit des Straßenverkehrs äußerst bedenklich ist, wurden dann zunächst auf den Anhängewagen besondere Beamte als Bremser angestellt, später richtete man durchgehende Bremsen ein, so dass jetzt vom Führerstand des Motorwagens auch die Räder des Anhängewagens mit gebremst werden.
Genau dasselbe findet man im Großen bei der Eisenbahn. Die Schaffung durchgehender Bremsen hat erst die große Geschwindigkeit unserer modernen Züge ermöglicht. Ohne durchgehende Bremsen wäre es geradezu ein Wahnsinnsakt, einen Eisenbahnzug mit 80 km/h Geschwindigkeit zu fahren. Wollte der Lokomotivführer schnell bremsen, so würde die gewaltige lebendige Kraft, die dem fahrenden Zug innewohnt, sein Dampfross wie einen Schlitten weite Strecken vor sich herschieben, und gäbe es ein Mittel, die Lokomotive plötzlich fest an die Schiene zu klammern, so würden die nachfolgenden Wagen mit furchtbarer Gewalt auflaufen, sich überstürzen, überschlagen und in Trümmer gehen wie bei einem Zusammenstoß.
Hierhin gehört auch das Problem der schnellfahrenden Güterzüge. Da kommt zur erstrebten hohen Geschwindigkeit noch das große Gewicht, die große Masse solcher Züge. Bisher verteilte man, wie bei der Straßenbahn, Beamte auf einzelne Wagen, die auf ein Pfeifensignal der Lokomotive hin die Bremsen anzogen, bei großer Geschwindigkeit muss man aber auch hier aus Sicherheitsgründen zur durchgehenden, von der Maschine bedienten Bremse greifen. Dahingehende Versuche haben in letzter Zeit wiederholt stattgefunden und zu recht guten Ergebnissen geführt, so dass die Einführung von Schnellgüterzügen bald zu erwarten steht.
In der ›lebendigen Kraft‹ haben wir eben eine von den Naturgewalten vor uns, die man nicht wegerfinden kann, sondern mit der man sich abfinden muss. Selbstverständlich entsteht sie nicht aus dem Nichts. Die lebendige Kraft, die einem in Bewegung befindlichen Körper innewohnt, kann nie größer sein wie die Kraft, die nötig war, den Körper in Bewegung zu versetzen. Wenn die Kraft, die ein Geschoss aus der Mündung des Laufs herausschleudert, 1000 Meterkilogramm beträgt, so wird die zerstörende Kraft dort, wo es aufschlägt, nicht größer sein können, es sei denn, dass man etwa von einem hohen Berge ins Tal schießt. In diesem Falle tritt die Anziehungskraft der Erde als zweite treibende Kraft hinzu. Im Gegenteil, stets wird ein Teil der Kraft unterwegs durch Luftreibung usw. verzehrt, oder richtiger in Wärme verwandelt, so dass am Ende des Fluges die zerstörende Kraft kleiner ist wie die treibende Kraft am Anfang. Auch hier gilt das Gesetz von der Erhaltung der Energie.
Die Kraft, die notwendig ist, um einem Eisenbahnzug die Geschwindigkeit von z. B. 60 km/h zu erteilen, muss durch eine etwa gleich große, aber entgegengesetzt wirkende Kraft wieder vernichtet werden, wenn er zum Stillstand kommen soll.
Man hat schon verschiedene Versuche gemacht, bei dieser Gelegenheit Arbeit zurückzugewinnen, indem man, statt direkt zu bremsen, die Räder der einzelnen Wagen z. B. mit einer Druckluftmaschine kuppelte. Dann muss der fahrende Wagen plötzlich Luft zusammenpressen, d. h. eine Arbeit verrichten. Die ihm innewohnende ›lebendige Kraft‹ wird dadurch aufgezehrt, und er kommt zum Stillstand. Soll er dann wieder weiterfahren, so benutzt man die zusammengepresste Luft umgekehrt, um die Räder zu drehen und so die Lokomotive zu unterstützen.
Auf elektrischen Bahnen ist bei einigen Systemen das gleiche möglich. Auch hier kann man während der Fahrt die Schaltung unter Umständen so ändern, dass die elektrische Maschine nicht mehr treibend auf die Räder wirkt, sondern sich von den Rädern treiben lässt, elektrischen Strom erzeugt und diesen in die Zentralstation zurückliefert. Das entspricht gleichfalls einer Rückwandlung der lebendigen Kraft in elektrische Energie.
Große praktische Bedeutung haben diese Einrichtungen bisher noch nicht gewonnen. Der erforderliche Mechanismus ist in der Regel nicht einfach genug, seine Kosten sind zu groß im Vergleich zu den erzielten Ersparnissen.«
In diesem Moment trat mir mein Gegenüber zum fünften Male auf meine Lackstiefel. Er hatte meinen Vortrag offenbar mit einem solchen Interesse angehört, dass er ganz die praktische Nutzanwendung vergaß, nämlich sich festzuhalten. Der Wagen stand, und ich stieg ab und eilte so schnell davon, wie es meine malträtierten Füße erlaubten.