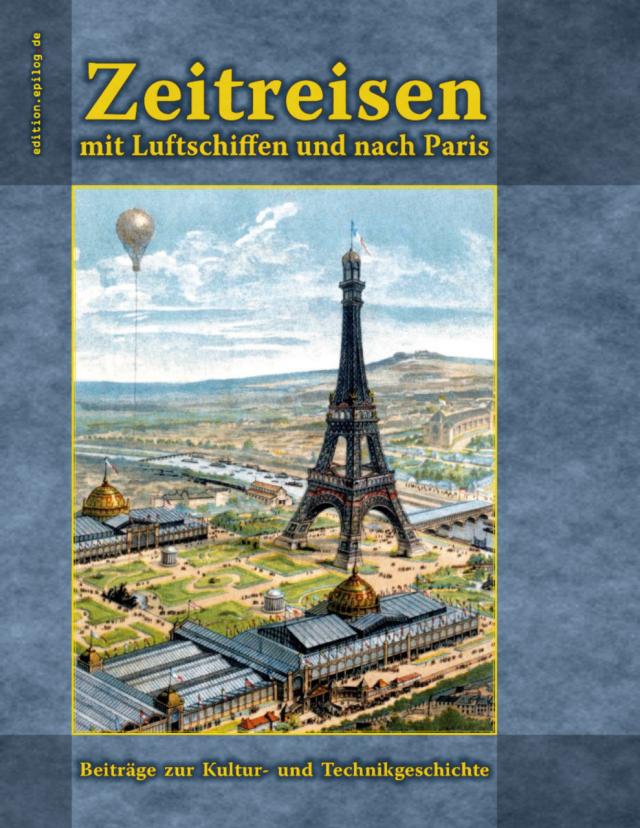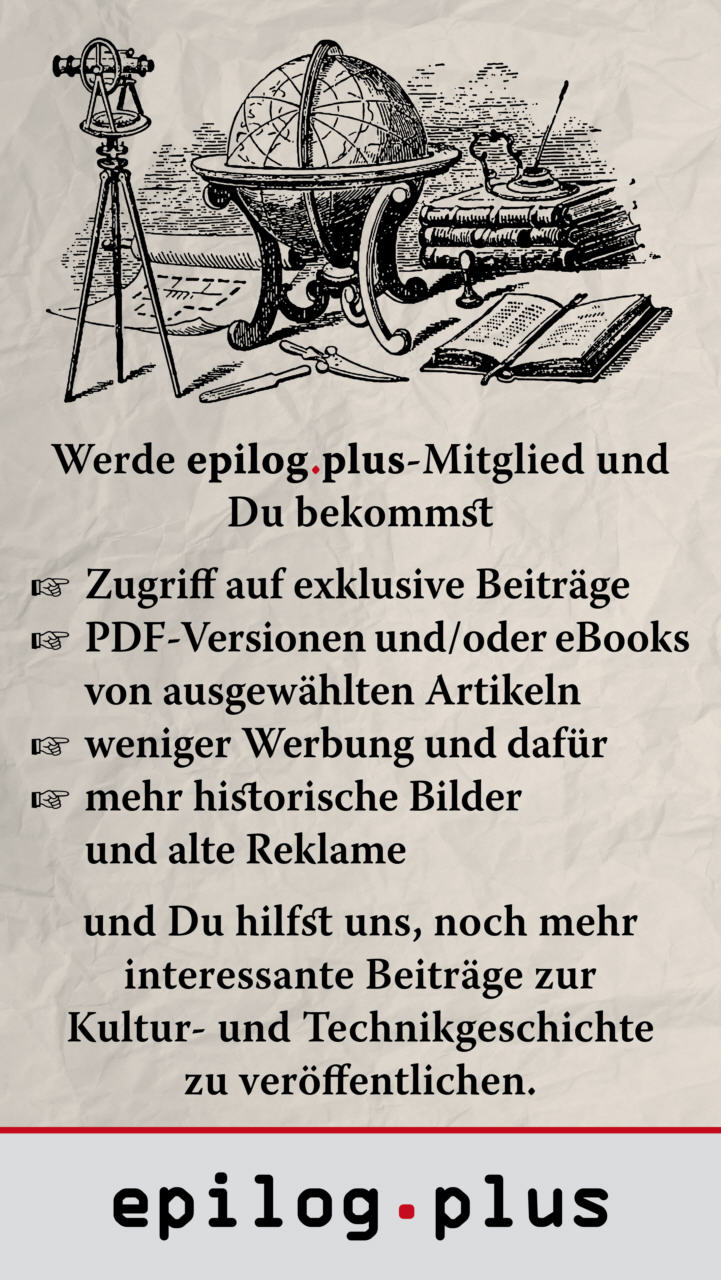Verkehr – Fernmeldewesen
Telefonkonzerte
Daheim • 19.1.1884
Als der Amerikaner Graham Bell das praktisch brauchbare Telefon erfunden hatte, erregte der verhältnismäßig einfache Apparat, vermittelst dessen das gesprochene Wort auf weite Entfernungen hin hörbar übertragen werden konnte, nicht nur allgemeines Aufsehen, sondern es bemächtigte sich die Praxis desselben, um den Fernsprecher den modernen Verkehrsmitteln hinzuzufügen und dem Drahtzwiegespräch eine hervorragende Stellung im öffentlichen und privaten Leben zu erobern. Ländliche Postanstalten sind nunmehr im deutschen Reich zahlreich mit den nächsten Telegrafenstationen durch Telefonanlagen verbunden, die billig in der Anlage sind und von dem Beamten nicht die Kenntnis des Telegrafierens verlangen, und was die Städte anbelangt, so sind sowohl große wie kleinere bereits in wenigen Jahren förmlich von Telefondrähten überspannt, welche dem lokalen Sprachverkehr dienen.
Es darf daher das Telefon als ein allgemein bekannter Apparat betrachtet werden, und da die Gelegenheit häufig geboten wird, haben die meisten Leser gewiss schon selbst einmal telefonisch gesprochen und gehört, so dass ihnen erinnerlich ist, wie das gesprochene Wort, trotz der Dämpfung, welche es erleidet, dennoch deutlich mit allen Eigentümlichkeiten der Klangfarbe an das Ohr gelangt. Man kann sogar Bekannte an der Stimme erkennen.
Das Telefon übermittelt daher nicht allein die Grundtöne, sondern auch alle Nebentöne, welche die Klangfarbe einer gesprochenen, gesungenen oder auf einem Instrument erklingenden Note hervorbringen und so lag der Gedanke nahe, auch den Versuch zu machen, die Klangmassen eines vollständig besetzten Orchesters durch das Telefon von einem Ort nach dem anderen zu übertragen. Das erste derartige Experiment wurde während der elektrischen Ausstellung zu Paris mit größtem Erfolg angestellt, indem man die große Oper mit dem Ausstellungspalast telefonisch verband und für geeignete, im Orchester angebrachte Schallfänger Sorge trug. Bald darauf wurde in ähnlicher Weise das Berliner Opernhaus mit dem Haupttelegrafenamt verbunden, aber nur Auserwählten ward der Zutritt in das Hörkabinett gestattet und später wurde in den Nebenräumen der Philharmonie in Berlin ein Hörkabinett eingerichtet, in welchem das Publikum die in dem Hauptsaal exekutierten Konzertnummern mittels Telefon vernehmen konnte. Da jedoch die Entfernung des Kabinetts vom Konzertsaal nur eine geringe ist, so wurden mehrere Kilometer Draht, welche passend auf Rollen gewickelt waren, in die Leitung eingeschaltet um den Weg, den die Musik nehmen musste, zu verlängern. An allen größeren Orten, wo elektrische Ausstellungen stattfanden, bildete die telefonische Musikübertragung einen Hauptanziehungspunkt, und da jedes Orchester und jedes Instrument als Musikquelle dienen kann, handelt es sich hauptsächlich um die Einrichtung der von fremden Geräuschen und Lärm möglichst unbehelligten Hörkabinette.

Unsere Illustration zeigt das Innere des Hörkabinetts und einige andächtige Lauscher, welche die Telefone möglichst nahe an die Ohrmuscheln halten, um keinen Ton von dem Orchester zu verlieren, das der Künstler in voller Tätigkeit dargestellt hat. Die Drähte, welche neben dem, in kleinem Format gezeichneten Orchester an der Wand herablaufen, führen nach dem sogenannten Transmitter, welche in unmittelbarer Nähe des Orchesters angebracht sind, um die Schallwellen aufzufangen und dieselben in schwache, elektrische Ströme zu verwandeln, welche sich im Telefon wieder in Schallwellen – Töne – umsetzen.
Der Effekt ist ein überraschender, denn obgleich die Kohlenspitzen der Transmitter, welche durch den Schall in leichte Bewegung versetzt werden, ebenso spitz sind wie geschärfte Bleistifte, so vermögen sie dennoch die gewaltigen Tonmassen selbst einer Wagnerschen Komposition ohne Verlust zu Gehör zu bringen. Freilich klingt die Musik gedämpft, als wäre der Hörer durch eine dünne Bretterwand von ihr getrennt, aber es fehlt kein Ton und keine Klangwirkung bleibt aus, sobald für eine zweckmäßige Aufstellung der Transmitter in der Nähe der Instrumente Sorge getragen wurde.
Ich hatte Gelegenheit, während der elektrischen Ausstellung zu München einen ganzen Akt des ›Tannhäuser‹ telefonisch im Ausstellungsgebäude zu hören, das eine Viertelstunde vom Hoftheater entfernt liegt. Vor dem Beginn der Ouvertüre vernahm man das Gemurmel des Publikums, das Stimmen der Instrumente und das Klappen der Sitze. Dann begann die Ouvertüre. Wie aus weiter Ferne drangen die gehaltenen Töne der Blasinstrumente an mein Ohr, mit welchen der Pilgerchor beim Anfang der Ouvertüre auftritt. Das Piano dieser Stelle brachte die Täuschung einer weiten Entfernung hervor; mit dem Crescendo schien das Orchester jedoch näher zu rücken, bis schließlich beim Forte die Töne in nächster Nähe hinter einer Wand zu erklingen schienen. Richtet man während des Hörens die Augen auf den Fußboden, so vermeint man, die Töne unter sich zu vernehmen, blickt man nach oben, so verlegt man den Sitz des Orchesters unwillkürlich über sich. Bei geschlossenen Augen dagegen hört das Ohr die Musik in ähnlicher Weise, wie die aus dem mystischen Abgrund des Bayreuther Wagnertheaters hervorquellenden Klänge und die Fantasie vermag nun sich die idealste Szenerie zu den Tönen hinzu zu träumen. Würde man, telefonisch hörend, gleichzeitig den Klavierauszug oder die Partitur des betreffenden Musikstückes oder der Oper mit den Augen studieren, so würde ein bis dahin unbekannter Genuss für jeden bereitet werden, der Musik ohne störende Nachbarschaft liebt und sich lernend mit einer Komposition beschäftigen möchte. Die gelesenen Noten erklingen dann gleichzeitig, und da das Telefon die Orchestermusik meilenweit überträgt, könnte der Musikfreund dieses Genusses in seinem Heim teilhaftig werden, wenn es dahin käme, dass die vorhandenen Telefonverbindungen an die Transmitter der Konzertsäle oder Opernhäuser angeschlossen würden, zumal der Realisierung dieses Gedankens keine Unmöglichkeiten hindernd entgegenstehen.
Das Telefon überträgt nicht allein die Klänge des Orchesters, sondern auch die menschliche Stimme und den Ausdruck, welchen der Sänger in seinen Gesang legt. Herr von Persall, der Intendant des Hoftheaters zu München, hat eine Telefonleitung von der Oper nach seiner Villa zu Tutzing am Starnberger See legen lassen und kann dort nicht allein den Verlauf der Aufführung verfolgen, sondern auch den Beifall des Publikums vernehmen. Selbst die Stellung der Sänger und Sängerinnen kontrolliert das Telefon, denn wendet der Sänger sich nach rechts, so hört das rechte Ohr deutlicher, wendet er sich nach links, dann umgekehrt. Erklingt der Ton besonders stark, so singt der Sänger gegen die an der Brüstung des ersten Ranges angebrachten Schallfänger und der Schluss, dass der Sänger um den lose sitzenden Beifall der oberen Ränge wirbt, ist ein durchaus richtiger. Das Merkwürdigste waren jedoch die Experimente auf der Telefonverbindung zwischen München, Tutzing am Starnberger See und Oberammergau, deren Leitung 95 km oder 30 Wegstunden betrug.
In Oberammergau hatte der Herr Lehrer für die Dauer der Ausstellung den musikalischen und deklamatorischen Teil unter Assistenz der am Passionsspiel mitwirkenden ländlichen Kräfte übernommen. Am Tage sprach der Lehrer mit den Hörern in München, oder spielte ihnen ein Stück auf der Geige oder dem Harmonium vor. Am Abend versammelten sich die Passionsspieler beim Lehrer und sangen Chöre oder Volksweisen, die trefflich zu Gehör kamen.
In dem etliche Wegstunden von Oberammergau entfernten Tutzing versah die sangeskundige Frau des im Glaspalast stationierten Inspektors des Oberammergaukabinetts den Telefondienst.
Der Inspektor ruft: »Käthe, es sind Hörer hier in München, kannst du ein Lied mit dem Herrn Lehrer in Oberammergau singen?«
Pause.
Wir hören darauf in München, wie Frau Käthe von Tutzing aus mit dem Lehrer in Oberammergau spricht: »Sind Sie da, Herr Lehrer?«
»Jawohl!«, tönt es von Oberammergau zurück, »was wünschen Sie?«
»Wir möchten ein Lied zusammen Singen!«
»Wollen Sie die zweite Stimme übernehmen?«, fragt der Inspektor von München den Lehrer in Oberammergau.
»Sehr gern!«
Pause.
Frau Käthe beginnt nun ein Lied zu singen; nach einigen Takten fällt der Herr Lehrer, der in seinem Telefon die Stimme der Frau Käthe genau hört, mit dem Bariton ein und wir vernehmen ein Duett, dessen Sänger mehrere Kilometer voneinander entfernt sind. Um das Maß des Merkwürdigen vollzumachen, begibt sich der Inspektor an einen Transmitter und singt die dritte Stimme zu dem Lied und das Terzett Oberammergau, Tutzing und München – Entfernung 95 km – ist komplett. Wäre die telefonische Tonübertragung keine Tatsache, so möchte man geneigt sein, sie für ein Erzeugnis der Fantasie zu halten. Sie ist aber eine Realität und dabei dennoch so überraschend und anziehend, dass wir jedem, dem sich die Gelegenheit bietet, raten, das Anhören von Telefonkonzerten nicht zu versäumen.
• Julius Stinde