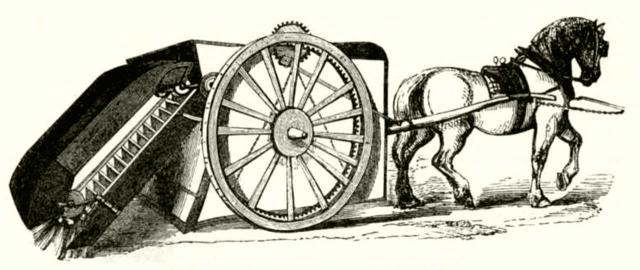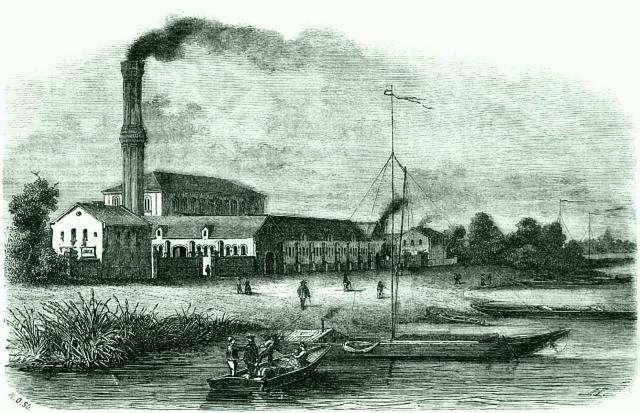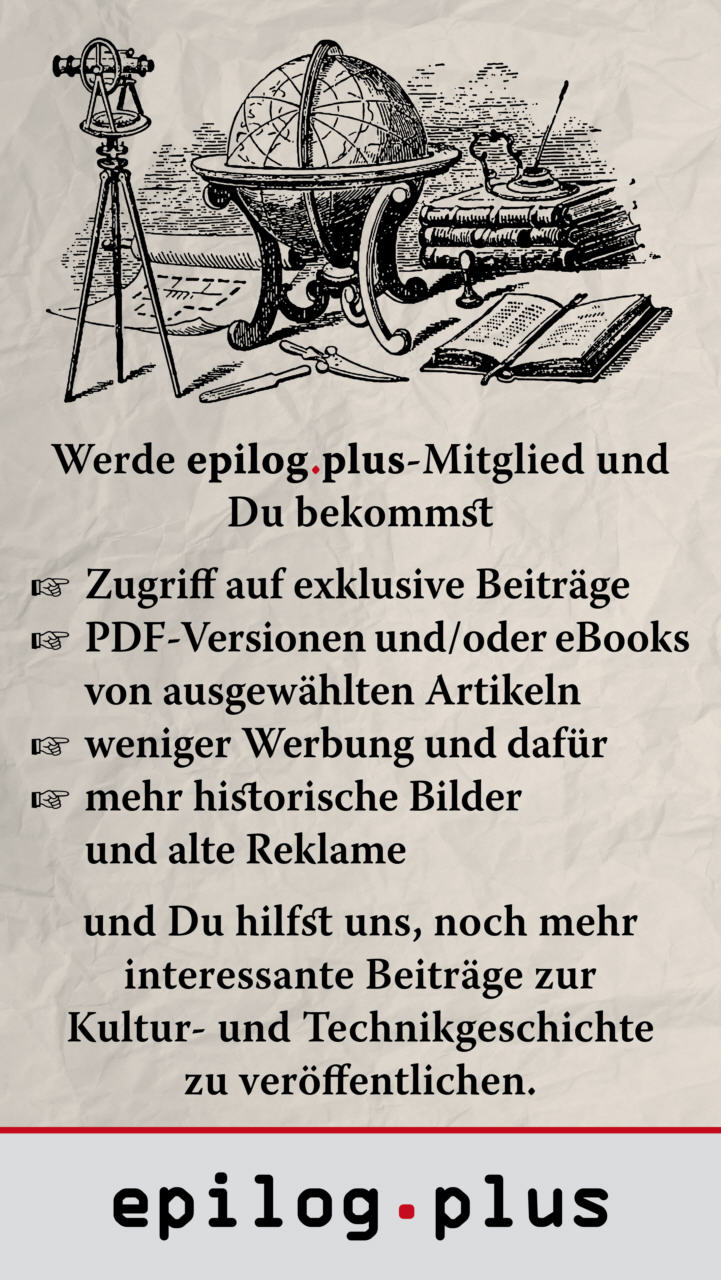Daseinsvorsorge – Kommunalwirtschaft
Atze von der Mülle
Meine Anfangszeit bei
der Berliner Stadtreinigung
von Hans-Günter Zimmer
1967–1974
Ein ehemaliger Kollege meines Vaters gehörte damals zum Betriebsrat der Berliner Stadtreinigung. Er hatte außerdem als Betriebsstellenleiter 40 Leute unter sich, vor allem Handreiniger und Kraftfahrer. Zu ihm ging ich hin. Gelassen musterte er mich: »Ja, dich nehme ich. Du kommst zu mir.« Den Kollegen kannte ich aus Kindertagen. Ich dachte: wunderbar, wenn du jemanden hast, der dich kennt. Protektion ist immer gut. Und so durfte ich am 1. Oktober 1967 als Straßenfeger anfangen, ausgerechnet im Wedding. Das gefiel mir gar nicht. Von meinem Chef wünschte ich mir: »Wenn ich schon als Straßenfeger ran muss, dann bitte nicht dort, wo ich wohne. Nicht im Wedding. In Reinickendorf.« Es wäre mir peinlich gewesen, in meinem Wohngebiet den Besen zu schwingen. Der Gedanke war alles andere als prickelnd.
Zunächst musste ich mich in der Luxemburger Straße im Wedding vorstellen. Dort erhielt ich meine Dienstsachen. In der Lengeder Straße wurde gerade ein neuer Betriebshof gebaut, nicht weit von unserer Wohnung entfernt. Der modernste Hof in ganz Europa, der Europahof. Noch mussten wir mit dem alten Hof vorlieb nehmen, sollten aber bald umziehen in den neuen. Dort gab’s Duschen, Waschbecken, Aufenthaltsraum. Nicht zu vergleichen mit heute. Wir saßen an Tischen neben den Garderobenschränken, wo die Käsesocken drin lagen. In dieser Atmosphäre wurde gegessen, gequalmt, zogen wir uns nach dem Duschen um. Alles in einem Raum, dem sogenannten Aufenthaltsraum, der als sehr modern galt. Für heutige Verhältnisse unvorstellbar. Dort also kam ich hin. Der Chef knapp: »So, das ist jetzt Ihre Betriebsstelle. Von hier aus werden Sie als Handreiniger eingesetzt.«
Erst mal Nägel aus Brettern zieh’n
Ich stellte ich mich darauf ein: Jetzt geht’s los mit fegen. Straßen fegen, Gehwege. Es wird anstrengend, aber schwächlich bist du ja nicht. Das schaffst du. Drei Wochen lang war ich mit dem Besen unterwegs. Doch weiter ging es damit erst mal nicht. Pustekuchen! Entgegen meiner Vorstellung hörte ich nur: »Hallo, Kollege Zimmer, geh’ jetzt mal in die Garage! Da sind Bretter. Zieh’ dort die Nägel raus!« Ich entgeistert: »Was soll ich machen? Ich denke, ich soll Straßen fegen?« In mir rumorte es.
 West-Berliner Straßenfeger in den 1950er Jahren. Jetzt bist du hier, willst Straßen fegen und musst Nägel aus irgendwelchen Brettern ziehen! Ich wunderte mich, meinte nur: »Ja, gut, mache ich.« Die Sache hatte einen simplen Hintergrund. Damals gab es in Berlin überall Bedürfnisanstalten mit Öfen. Diese mussten mit Brennholz versorgt werden. Die Kollegen der Sperrmüllabfuhr brachten die ausgesonderten Schränke der Berliner Bürger zur Verwertung auf die Betriebsstelle. Damit sparten sie die langen Fahrten zur Mülldeponie. Das bedeutete, dass alle Nägel aus den Holzteilen entfernt werden mussten. Das Material ließ sich auch gut als Brennholz verkaufen. Das daraus erwirtschaftete Geld steckte sich der Betriebsstellenleiter ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Zwei Mark kostete der Sack. Ich wunderte mich, als es hieß: »Heute biste mal mit auf Tour, ausliefern!« Ich kam mir vor wie ein Kohlenträger. Vollgepackt mit Holz trug ich die Säcke nach oben in verschiedene Wohnungen, kassierte besagte zwei Mark pro Sack. Und so machte der eine oder andere Stadtreiniger schon damals seine kleinen, krummen Geschäftchen. Als junger, neuer Kollege hatte ich die Klappe zu halten. Ich erhielt monatlich meine Kohle. Das war’s.
West-Berliner Straßenfeger in den 1950er Jahren. Jetzt bist du hier, willst Straßen fegen und musst Nägel aus irgendwelchen Brettern ziehen! Ich wunderte mich, meinte nur: »Ja, gut, mache ich.« Die Sache hatte einen simplen Hintergrund. Damals gab es in Berlin überall Bedürfnisanstalten mit Öfen. Diese mussten mit Brennholz versorgt werden. Die Kollegen der Sperrmüllabfuhr brachten die ausgesonderten Schränke der Berliner Bürger zur Verwertung auf die Betriebsstelle. Damit sparten sie die langen Fahrten zur Mülldeponie. Das bedeutete, dass alle Nägel aus den Holzteilen entfernt werden mussten. Das Material ließ sich auch gut als Brennholz verkaufen. Das daraus erwirtschaftete Geld steckte sich der Betriebsstellenleiter ein, ohne mit der Wimper zu zucken. Zwei Mark kostete der Sack. Ich wunderte mich, als es hieß: »Heute biste mal mit auf Tour, ausliefern!« Ich kam mir vor wie ein Kohlenträger. Vollgepackt mit Holz trug ich die Säcke nach oben in verschiedene Wohnungen, kassierte besagte zwei Mark pro Sack. Und so machte der eine oder andere Stadtreiniger schon damals seine kleinen, krummen Geschäftchen. Als junger, neuer Kollege hatte ich die Klappe zu halten. Ich erhielt monatlich meine Kohle. Das war’s.
Einer wollte Pilot werden
Erst einige Zeit später durfte ich wieder auf die Straße, ließ man mich fegen. Dabei lernte ich meine Kollegen näher kennen. Ich grübelte: »Was sind das für welche?« Früher, zu meiner Anfangszeit, waren Straßenreiniger ein ganz anderes Klientel als heute. Im Vergleich zu jener Zeit hat sich sehr viel verändert. Der Erste, der mir begegnete, hieß Detlef. Den Namen vergesse ich nie. Er fragte mich gleich: »Warum bist du denn hier?« »Ich war bei der Bank. Dort hat es mir nicht gefallen.« Und er: »Na, ja. Ich wollte Pilot werden.« Ich traute meinen Ohren nicht. Was wollte der werden? Pilot? Und jetzt rennt der Typ mit einem Besen rum. Aber wegen seiner schlechten Augen soll dieser Traum geplatzt sein, wie ich heraushörte. Der hatte so ’ne dicke Hornbrille! Der Nächste – angeblich ein Architekt … Jeder fühlte sich zu etwas Höherem berufen, angestachelt von mir, da ich von der Bank kam. Ich fühlte mich wie im Gefängnis. Alle erzählten, sie seien unschuldig bei der Straßenreinigung gelandet. Aber keiner von denen war tadellos, jeder auf seine Weise geschädigt. Die konnten froh sein, sich als Straßenfeger nützlich zu machen. Selbst das fiel manchen schwer.
Jetzt ziehen wir den Stecker …
Jetzt also gehörte ich zur Gilde der Straßenreiniger! Was gestern war, zählte nicht mehr. Wir standen herum, und schon stichelte einer aus der Mitte: »Hey, du bist neu hier, gib’ mal ’n paar Bier aus!«
 Straßenreiniger der BSR um 1970. »Das hab’ ich mir schon gedacht«, erwiderte ich und schmiss eine Runde Gerstensaft. Danach fegten wir ›fröhlich‹ weiter bis zur offiziellen Pause halb zehn. Die ging bis zehn. Dann fuhren wir wieder raus, fegten bis 13 Uhr. Als das Kapitel vorbei war, standen wir eine ganze Weile an einer Ecke, bis unser Vorarbeiter signalisierte: »So, jetzt zieh’n wir den Stecker. Jetzt ist Schluss!« Ich kam mir vor, als wollten die mich verarschen. Bis 15 Uhr musst du arbeiten! Und die erzählen dir um eins: »Jetzt ist Feierabend!« Alle standen da, guckten auf die Uhr, tranken noch ein Bierchen. Dann war’s halb zwei. Mir ging durch den Kopf: Irgendwann müssen wir ja wieder anfangen zu arbeiten. Aber daraus wurde nichts. Es war tatsächlich Ende. Was ist das hier für ein Job? fragte ich mich insgeheim. Um eins war die Tour geschafft. Alle Straßen gefegt im Revier. Laut Plan. Das kannte ich nicht, staunte, wie man zwei Stunden vor offiziellem Schluss fertig sein konnte mit seiner Arbeit. Der letzte Akt des Tages: fünf Minuten Waschzeit. Mein Fazit nach meinem ersten Einsatz als Straßenfeger: Vielleicht ist es hier gar nicht mal so schlecht. Hier kannst du alt werden!
Straßenreiniger der BSR um 1970. »Das hab’ ich mir schon gedacht«, erwiderte ich und schmiss eine Runde Gerstensaft. Danach fegten wir ›fröhlich‹ weiter bis zur offiziellen Pause halb zehn. Die ging bis zehn. Dann fuhren wir wieder raus, fegten bis 13 Uhr. Als das Kapitel vorbei war, standen wir eine ganze Weile an einer Ecke, bis unser Vorarbeiter signalisierte: »So, jetzt zieh’n wir den Stecker. Jetzt ist Schluss!« Ich kam mir vor, als wollten die mich verarschen. Bis 15 Uhr musst du arbeiten! Und die erzählen dir um eins: »Jetzt ist Feierabend!« Alle standen da, guckten auf die Uhr, tranken noch ein Bierchen. Dann war’s halb zwei. Mir ging durch den Kopf: Irgendwann müssen wir ja wieder anfangen zu arbeiten. Aber daraus wurde nichts. Es war tatsächlich Ende. Was ist das hier für ein Job? fragte ich mich insgeheim. Um eins war die Tour geschafft. Alle Straßen gefegt im Revier. Laut Plan. Das kannte ich nicht, staunte, wie man zwei Stunden vor offiziellem Schluss fertig sein konnte mit seiner Arbeit. Der letzte Akt des Tages: fünf Minuten Waschzeit. Mein Fazit nach meinem ersten Einsatz als Straßenfeger: Vielleicht ist es hier gar nicht mal so schlecht. Hier kannst du alt werden!
Es gab auch andere Zeiten, wo wir hart ran mussten. Ich denke da an den Winter 1969/70, als sich Schneeberge türmten. Damals waren 12-Stunden-Tage angesagt. Jedenfalls erlebte ich so einiges als Straßenfeger. In diesem Bereich gab es schon damals eine bestimmte Hierarchie. Kraftfahrer stand ganz oben. Straßenfeger schien das Letzte zu sein. Ein halbes Jahr war ich Straßenfeger, machte in dieser Zeit meinen Führerschein, wurde Reservekraftfahrer bei der Straßenreinigung, fuhr Ladefahrzeuge, Kehricht-Sammelwagen und Ladekranwagen.
Das Ding mit Bernhardt
Der Vorarbeiter hatte vor Ort immer das Zepter in der Hand. An seiner Seite ein Kraftfahrer und vier, fünf Handreiniger. Die bildeten eine Kolonne. Als Neuer war ich froh, als der Chef verkündete: »Ja, den nehm’ ich. Der ist fleißig.« Mit in die Kolonne kam Bernhard als neuer Vorarbeiter. Ein bisschen verrückt, der Typ. Er wohnte mitten in einer Laubenkolonie. Genau an dieser Stelle schoss Ende der 60er Jahre das Märkische Viertel hoch. Als die neuen Häuser dort standen, nahmen die Leute ihre Karnickel und Hühner mit auf ihre Balkons. Ihre Gärten wurden vorher regelrecht platt gemacht. Bernhardt schraubte gern an Autos. Eines Tages verklickerte er mir: »Günter, mir müssen ein Auto abholen von einem Kumpel, es an eine andere Stelle bringen.« Es handelte sich um einen alten Opel Admiral. Noch im Dunkeln, morgens um sechs, startete die Aktion. Ich hing das Auto hinten an unseren Lkw, fuhr die Rödernallee lang. Ich wunderte mich darüber nicht, reimte mir meinen Text dazu. Wenn Bernhardt das so sagt, dann mache ich es eben. Es ging also los. Der PKW schlenkerte hin und her, rutschte rüber in die andere Fahrspur. Gelbe Lampe oben an. Alles toll. BSR macht den Abschlepper! Ich brachte mit Hängen und Würgen den Opel in die andere Straße. Der Empfänger drückte mir fröhlich 20 Mark in die Hand. »Hier, haste für die Extraarbeit. Mein Kumpel bezahlt das!«
Hinterher kriegte ich mit, dass die beiden den Motor brauchten. Die Karre stand schon eine Weile auf ihrem Fleck, komplett platt. Von dort holten sie das Fahrzeug einfach weg, um es woanders auszuschlachten. Ich Idiot brachte das Auto dort hin! Heute fasse ich mir an den Kopf, kann es kaum glauben, welche krummen Dinger damals zum Alltag gehörten.
Oh, der Chef kommt!
Das frühere Pensum bei der Straßenreinigung war nicht viel weniger als heute. Es wurde gründlicher gefegt. Heutzutage kommen mehr Kehrfahrzeuge, Saugwagen zum Einsatz. Wir mussten überall noch mit Besen und Schippe ran. Zweimal am Tag wurde kontrolliert, mindestens. Vormittags und nachmittags. In meinen Anfangsjahren fuhren die Kontrolleure noch mit Mopeds, später mit grauen VW-Bussen. Wenn jemand von uns Kontrolle witterte, gab’s schnell ein Zeichen an die Kolonne: »Oh, der Chef kommt!« Dann schrubbte jeder mit seinem Besen, dass die Borsten glühten. Pflichtgemäß erschienen alle in Uniform und Mütze. Schirmmütze sah nun mal blöd aus bei mir. Bei meinen Beatleslocken! Immer wieder wurde ich gemaßregelt: »Herr Zimmer! Ich hab’ Sie heute gesehen. Sie hatten schon wieder Ihre Mütze nicht auf!« Egal, das Ding musstest du aufhaben, sonst drohte eine Abmahnung.
In meiner Reinigerzeit lernte ich einige Tricks kennen. Als Erstes wurde mir beigebracht: Wenn du einen kleinen Haufen zusammengefegt hast, kommt der Dreck längst nicht auf die Schippe. Gott bewahre! »Nicht gleich auf die Schippe! Wenn ein Gully kommt, fegste den da drunter! Wenn ein Auto kommt, schiebste den unters Auto!« Ich fing an, mir ’ne Platte zu machen. Was denn nun? Ich denke, ich soll den Dreck wegmachen? Meine Kollegen verbuchten das als Arbeitserleichterung. Diese kleinen Betrügereien lernte man damals gleich.
 Gullyreinigung mit einem Baggersaugwagen im West-Berlin der 1970er Jahren.
Gullyreinigung mit einem Baggersaugwagen im West-Berlin der 1970er Jahren.
Jeder hatte ein großes Gebiet zu fegen. Vier bis fünf Kilometer am Tag bist du gelaufen. Innenkante, Außenkante … Gehwegbreiten wurden gar nicht bedacht. Heute zählt das alles mit zur Leistungsberechnung. Da heißt es: Wenn der Gehweg breiter ist, sind weniger Kilometer zu fegen. Wenn du eine breite Straße fegen musstest, in Reinickendorf zum Beispiel, mit vielen Läden, hattest du Pech. Hier gab es viel mehr Schmutz als in Neubaugebieten. Eine Kolonne hatte fünf Touren.
Einer hielt den Besen raus …
Jeden Tag wurde woanders gefegt. Jede Kolonne war für eine bestimmte Tagestour zuständig. Wir hatten Glück, wenn die Straßen mal nicht so dreckig waren. Dann fuhren die Jungs lang an der Kante mit dem Lkw. Einer hielt den Besen raus, und fertig war der Besenstrich.
Unser Chef guckte nach einer Besenspur an der Kante. Prinzipiell werden Straßen nur an den Rändern gefegt. Erst Mitte der 70er Jahre ging es los mit Kleinkehrmaschinen. Kranwagen hatten wir damals nicht. Im Winter landete das Streugut per Schippe aufs Fahrzeug, um es dann auf den Straßen zu verteilen. Heute gibt es dafür Radlader. Der fährt ran, zack und rauf. Früher mussten wir alles mit der Hand erledigen. Eine körperliche Plackerei war das! Oft mit Rückenschmerzen verbunden. Heutzutage gibt es einen riesen Maschinenpark, der die Arbeit enorm erleichtert.
Straßen zu fegen schien mir herabwürdigend. Erst als ich Kraftfahrer sein durfte, kam ein gewisser Stolz durch. Als Reservekraftfahrer wurde ich eingesetzt, wenn jemand im Urlaub oder krank war. Damit kletterte ich eine Stufe nach oben in der Beförderungsskala der Berliner Stadtreinigung. Fahrer von Spezialfahrzeugen wurden noch besser bezahlt. Ich denke da an Fahrer von Kehrrichtsammelfahrzeugen oder Ladekränen. Das Höchste war Baggersaugwagenfahrer. Dafür gab’s das meiste Geld, bedeutete den Aufstieg bei uns im Betrieb. Wer mehr drauf hatte, kam vielleicht zur Müllabfuhr.
Augen zu und durch!
In West-Berlin gab es viele freie Grundstücke und Plätze, die geräumt werden mussten. Dort warfen Bürger ihre alten Matratzen hin, ihr ganzes Gerümpel. Die Stadt rief dazu auf, diese Müllplätze zu säubern. Wer wollte, konnte sich für die Ruinenreinigung bewerben, fürs Flohkommando, wie sich die Truppe nannte.
 Ende der 1970er Jahre kamen Kraftfahrer der Sperrmüllabfuhr auch bei der Müllabfuhr zum Einsatz. Zwei Kolonnen hatte die Stadtreinigung zu dem genannten Zweck zwischen 1969 bis 1971 im Einsatz. Ich gehörte dazu, mit 21. Dafür gab es wieder mehr Geld. Wir kümmerten uns um die Dreckecken Berlins, machten sie sauber.
Ende der 1970er Jahre kamen Kraftfahrer der Sperrmüllabfuhr auch bei der Müllabfuhr zum Einsatz. Zwei Kolonnen hatte die Stadtreinigung zu dem genannten Zweck zwischen 1969 bis 1971 im Einsatz. Ich gehörte dazu, mit 21. Dafür gab es wieder mehr Geld. Wir kümmerten uns um die Dreckecken Berlins, machten sie sauber.
Wieder mal trat unser Betriebshofleiter an mich heran: »Herr Zimmer, könnse lesen und schreiben?« »Ja, kann ick!« »Jut, hier hamse fünf Mann. Sie sind ab jetzt Vorarbeiter, kriegen en Auto, machen die Grundstücke und Ruinen sauber.« Jeweils vom Frühjahr bis zum Herbst räumten wir alles weg, was da so rum lag, nicht nur Dreck … Ich erinnere mich genau an die aufgedonnerten Damen an der Tiergartenstraße, an die alten, durch den Krieg zerbombten Botschaftsgebäude. Ringsum befanden sich Gärten, alles war offen, ohne Zaun. Freudendamen fuhren mit ihren aufgedrehten Freiern dort hin, erledigten in Büschen und Autos ihr ›Geschäft‹. Überzieher samt benutzten Taschentüchern flogen durch die Gegend. Wir mussten das Zeug zusammenharken, mit Schippen auf einen Lkw laden, und ab ging die Post. Dafür gab’s schließlich mehr Geld. In meiner Reinigerzeit hatte ich oft mit ekligen, unangenehmen Sachen zu tun.
Die Tätigkeit im Flohkommando war reine Saisonarbeit. Der Hofleiter konnte entscheiden: »Ja, den will ich wieder haben.« Also muckte keiner groß auf. Jeder gab sich Mühe, erledigte ordentlich seinen Job. Hauptsache weg von der Reinigung! Manchmal hatte ich Pech, kam halb drei auf den Hof, freute mich auf meinen Feierabend.
 Im Einsatz für die Berliner Stadtreinigung. Plötzlich tönte es hinter mir mit trunkener Stimme: »Hey, Kollege Zimmer, ich hab’ noch was. Können Sie mich bitte nach Hause fahren.« Da konnte ich schlecht Nein sagen. Im nächsten Jahr hätte er mich auf keinen Fall angefordert. Ich versuchte, wenn ich auf den Hof kam, mich jedes Mal zu verstecken. In der Dusche oder im Umkleideraum. Das klappte nicht immer. Bis 17 oder 18 Uhr verlängerte sich meine ›Arbeitszeit‹, wenn er mich erwischt hatte. Und so musste ich mit seinem Dienstwagen von Kreuzberg nach Zehlendorf kutschieren und wieder zurück. Bezahlt kriegte ich die Einsätze nicht. Das kam alles auf meine Kappe.
Im Einsatz für die Berliner Stadtreinigung. Plötzlich tönte es hinter mir mit trunkener Stimme: »Hey, Kollege Zimmer, ich hab’ noch was. Können Sie mich bitte nach Hause fahren.« Da konnte ich schlecht Nein sagen. Im nächsten Jahr hätte er mich auf keinen Fall angefordert. Ich versuchte, wenn ich auf den Hof kam, mich jedes Mal zu verstecken. In der Dusche oder im Umkleideraum. Das klappte nicht immer. Bis 17 oder 18 Uhr verlängerte sich meine ›Arbeitszeit‹, wenn er mich erwischt hatte. Und so musste ich mit seinem Dienstwagen von Kreuzberg nach Zehlendorf kutschieren und wieder zurück. Bezahlt kriegte ich die Einsätze nicht. Das kam alles auf meine Kappe.
Manchmal fanden wir im Sperrmüll Geld. Schon früher gab es solche Coktailsessel, diese runden, die wohl jeder kennt. Oft war es so, dass den Leuten mal ein paar Groschen oder eine Mark da rein rutschten, auch in andere Sessel oder Sofas. Als Erstes, wenn wir einen Sessel abholten, rüttelten wir ihn kräftig. Und wenn es klapperte, rissen wir die Lehnen auseinander, und der ›Rubel‹ rollte.
 Damit verdienten wir uns öfter mal ein bisschen Taschengeld dazu. Von unseren älteren Kollegen lernte ich die Tricks, wie man nebenbei Geld verdienen kann. So sammelten wir Federbetten, die man verkaufen konnte. Buntmetall, Antiquitäten und alte Möbel schafften wir zu Trödelläden. Die Leute wollten jede Menge wegschmeißen. So hatten wir neben unserem Lohn eine nicht unerhebliche Einnahmequelle. Das wurde stillschweigend hingenommen.
Damit verdienten wir uns öfter mal ein bisschen Taschengeld dazu. Von unseren älteren Kollegen lernte ich die Tricks, wie man nebenbei Geld verdienen kann. So sammelten wir Federbetten, die man verkaufen konnte. Buntmetall, Antiquitäten und alte Möbel schafften wir zu Trödelläden. Die Leute wollten jede Menge wegschmeißen. So hatten wir neben unserem Lohn eine nicht unerhebliche Einnahmequelle. Das wurde stillschweigend hingenommen.
Die Stadt sah aus wie nach dem Krieg
Unter dem Motto ›Sauberes Berlin – schönere Umwelt …‹ lief ab Frühjahr 1972 – erstmalig nach dem Krieg in West-Berlin – eine aufwendige Entsorgungsaktion des Berliner Senats. Damit wollten die Politiker ihr Wahlversprechen einlösen, wilde Mülldeponien zu beseitigen und übervolle Keller der Bürger endlich einmal komplett entrümpeln zu lassen. Und zwar kostenlos. Finanziert wurde das Ganze über die Umlage in der Gebühr der grauen Mülltonne. Alles, was in den Kellern lagerte, vor allem vom Ersten und Zweiten Weltkrieg, sollte rausgestellt werden. Dafür machte der Senat ’zig Millionen Mark locker, gründete eine Sperrmüllabfuhr. 50 Sperrmüllpresswagen wurden neben anderen Fahrzeugen angeschafft, 200 Leute gesucht. Ich bewarb mich dafür.
 Nach drei Jahren war Schluss mit der Aktion »Sauberes Berlin – schönere Umwelt …« Der Standort befand sich in Lichtenrade. Ich wohnte im Wedding, musste quer durch die ganze Stadt fahren. Als Betriebshof diente ein ehemaliges Sinterwerk, direkt an der Berliner Mauer, die Volkspolizisten konnten bei uns reingucken. Das Werk wurde zum Betriebshof umgebaut. Überall hat’s gezogen, gepfiffen, auf mehreren Etagen.
Nach drei Jahren war Schluss mit der Aktion »Sauberes Berlin – schönere Umwelt …« Der Standort befand sich in Lichtenrade. Ich wohnte im Wedding, musste quer durch die ganze Stadt fahren. Als Betriebshof diente ein ehemaliges Sinterwerk, direkt an der Berliner Mauer, die Volkspolizisten konnten bei uns reingucken. Das Werk wurde zum Betriebshof umgebaut. Überall hat’s gezogen, gepfiffen, auf mehreren Etagen.
Die Stadt wurde zweimal im Jahr ›entsorgt‹. Sie sah jedes Mal aus wie nach dem Krieg. Im ersten Jahr waren täglich Mehrleistungen zu erbringen. Teilweise ragten riesige Sperrmüllberge in den Häuserschluchten über die ersten Stockwerke hinaus. Neben Wanduhren, Kommoden, Tischen und Stühlen, Betten, Schränken und Lampen türmten sich Gas- und Elektrogeräte an den Straßenrändern. Die verrücktesten Sachen flogen bei den Leuten raus, immer mehr Kleinteile durch die Gegend. Hinzu kamen Unmengen an Gewerbemüll. Wir luden den Krempel auf Sperrmüllpresswagen, fuhren damit weg zu den Deponien der BSR. Nach uns kamen Reinigungskolonnen zum Einsatz. Gebündelte Pappe, Zeitungen und Illustrierte wurden vom Berliner Altstoffhandel abgeholt. Zettel an den Haustüren kündeten die Termine für alles an. Eine Woche vorher wussten die Bürger Bescheid. Tagelang vor der Abfuhr stapelte sich der Sperrmüll. Plünderer und Trödler suchten sich dort das Beste raus, wühlten überall rum, vor allem nachts. Drei Jahre lang zogen wir die Aktion durch, bis sie eines Tages eingestellt wurde.
© copyright 2012 by Hans-Günter Zimmer